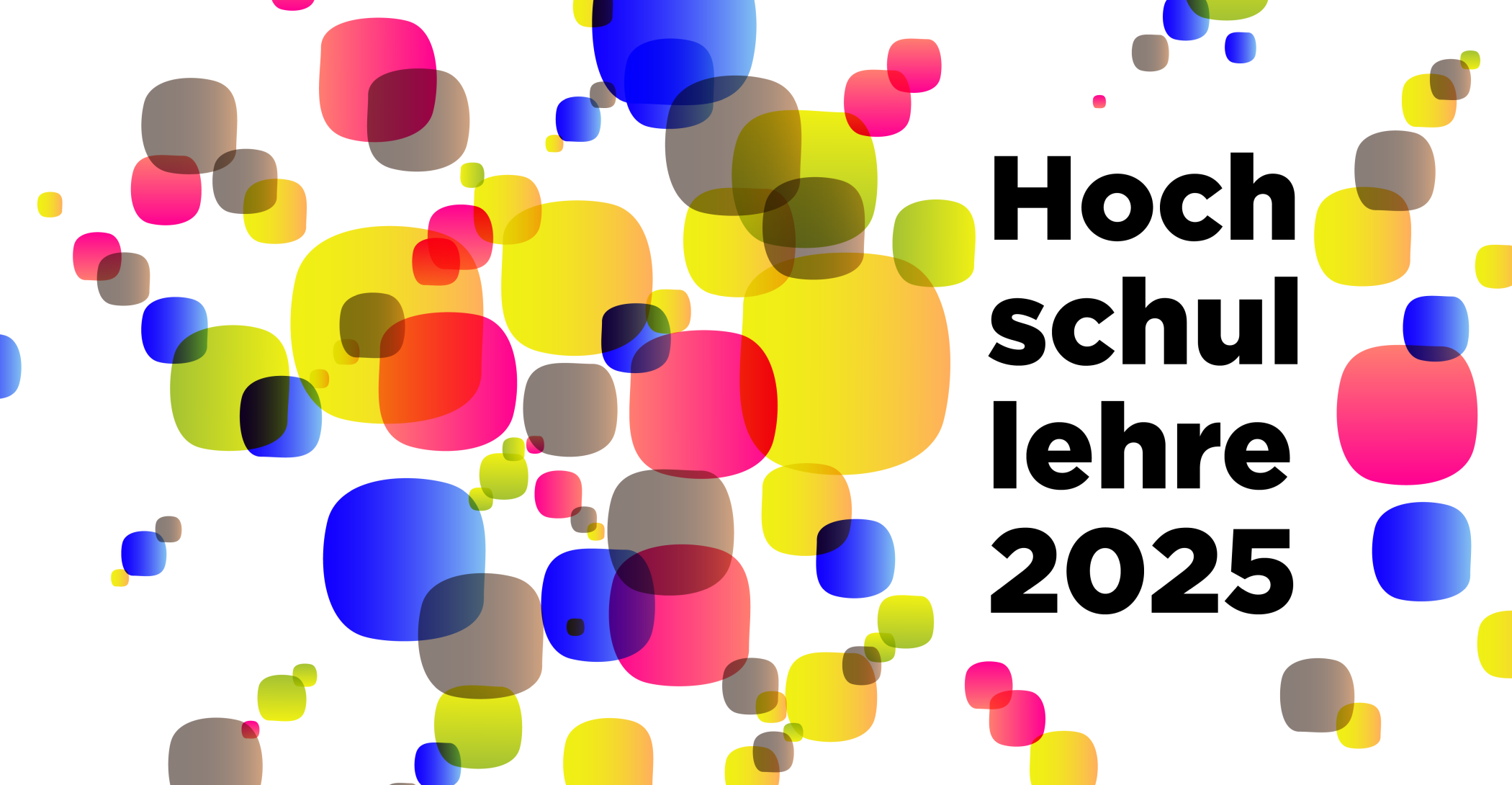Hochschullehre 2025
Den digitalen Wandel in der Lehre gestalten
Die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Arbeitswelt und die Gesellschaft, sie hat auch viel Dynamik in die Hochschulwelt gebracht. Im strategischen Entwicklungsschwerpunkt «Hochschullehre 2025» erprobte, evaluierte und implementierte die FHNW von 2018–2024 digital unterstützte Lehr- und Lernformate.
Die Ergebnisse sind in der Abschlusspublikation Hochschullehre 2025 (PDF, 8 MB) festgehalten.