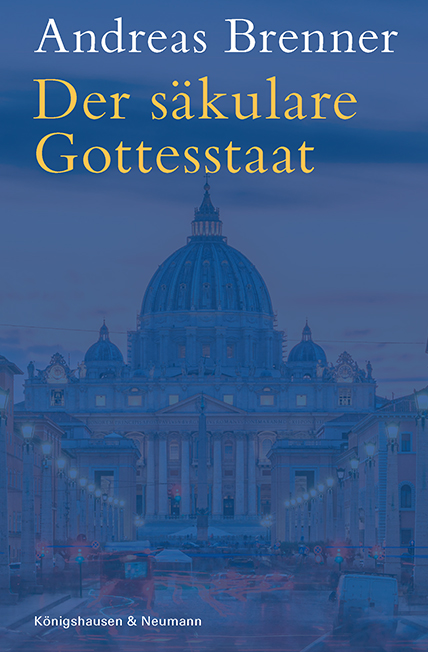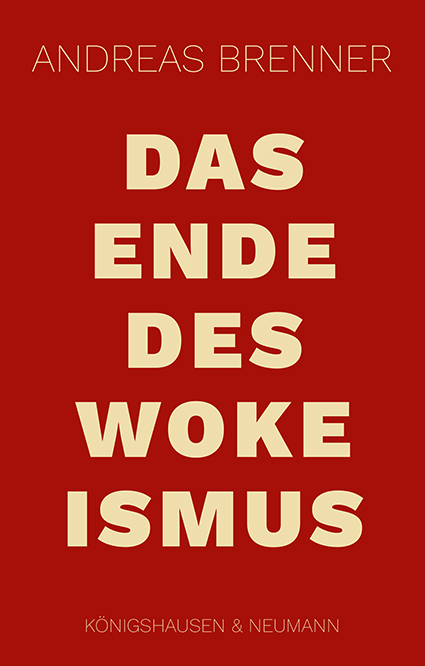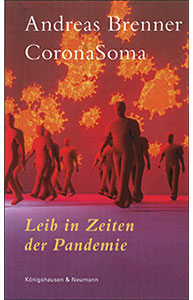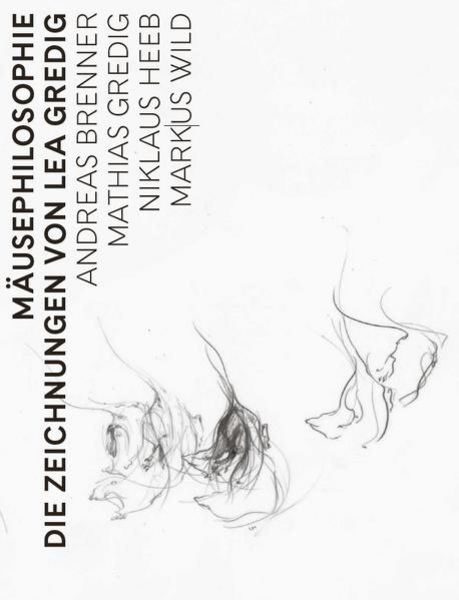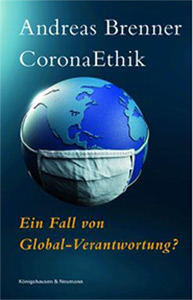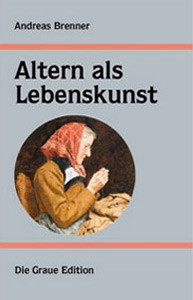Tätigkeiten an der FHNW
- Dozent für Philosophie, Globalisierung und Wirtschaftsethik
- Leiter des Schwerpunktes Public Governance und Wirtschaftsethik
Beruflicher Werdegang
- Seit 2015 Mitglied am von der Universität Basel und des FHNW getragenen "Instituts für Bildungswissenschaft", IBW.
- seit 2011 Professor an der FHNW in Basel
- Habilitation an der Universität Basel 2006, seit 2010 Titularprofessor für Philosophie der Universität Basel
- Seit 1999 Dozent an der FHBB bzw. Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW, Lehraufträge an den Universitäten Freiburg, Fribourg und St. Gallen.
- 1999-2000 Mitglied im Graduiertenkolleg des "Interfakultären Zentrums für Ethik in den Wissenschaften" der Universität Tübingen.
- 1994-1999 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam und Journalist in Berlin
- Studium der Philosophie, Geschichte und Kunstgeschichte an den Universitäten in Bonn, Zürich (lic. phil.) und Basel (Promotion)
Netzwerke/Mitgliedschaften
- Schweizerische Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (SVRSP)
- Historische Gesellschaft für Anthropologie, Berlin
Ausbildung
- Dozent für Philosophie, Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit, Globalisierung
- Verantwortlich für die FHNW-Ringvorlesung in Basel, www.fhnw.ch/ringvorlesung
- Betreuung von Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten
Weiterbildung
- Dozent für Public Governance und Wirtschaftsethik in unseren Weiterbildungsprogrammen
- Café Dialogue in Basel: Impulsreferate und moderierte Diskussionen mit Seniorinnen und Senioren
Spezialgebiet
- Ethik in Unternehmen und Gesellschaft
- Verantwortlich für die Ringvorlesung, Campus Basel
Beratung
- Ethische Expertise im Bereich der Angewandten Ethik
Forschung zur angewandten Ethik, insbesondere der Medizin-, Tier-, Umwelt- und Wirtschaftsethik sowie zur Phänomenologie, insbesondere der Leibphilosophie
Der säkulare Gottesstaat
In den modernen Staaten sind Veränderungen zu beobachten, die man noch vor Kurzem für schier unmöglich gehalten hätte: Wer sich satirisch über Politiker äußert, muss mit einer Strafverfolgung rechnen; neue Gesetze sollen verhindern, dass die öffentliche Meinung durch Falschinformationen irritiert wird und ein diffuser Begriff von Verschwörungstheorie kann unliebsame Positionen aus der öffentlichen Debatte verbannen und ihre Autoren mit einem indirekten Sprech- oder Schreibverbot belegen. Wenn man sich fragt, was zu dieser Schieflage der Demokratie geführt hat, dann kommt schnell die Rede auf das Wirtschaftssystem und auf die Alternative Demokratie oder Kapitalismus. Mit dem Einfluss des modernen Kapitalismus kann aber die Demokratiekrise nicht vollständig erklärt werden.
Der vorliegende Essay wählt daher einen bislang nicht berücksichtigten Zugang: Die modernen Demokratien, die sich als weltanschauungsneutral betrachten, argumentieren zunehmend religiös und entwickeln sich in Richtung säkularer Gottesstaaten. Und so zeigt sich, dass sowohl der von Augustinus stammende Begriff des Gottesstaates und das Staatskonzept Thomas von Aquins sowie weitere Positionen der mittelalterlichen Philosophie für die modernen Staaten zum Vorbild geworden sind. Diese Orientierung erläutert das staatliche Handeln in der Gegenwart und erklärt auch Irritationen in der demokratischen Gesellschaft.
Das Ende des Wokeismus
Innerhalb weniger Jahre hat sich das öffentlich-kulturelle Leben in Europa und den USA dramatisch gewandelt. Begriffe, die bis dahin in ganz anderen Bereichen eine Rolle spielten, beispielsweise an Flughäfen, regeln und reglementieren nun auch das Leben derjenigen am Boden: Es wird gecancelt oder es werden Safe Spaces geöffnet. So wie ein Flug plötzlich von der Anzeigentafel verschwindet, so verschwinden ganz unvermittelt Vortragstitel aus den Programmen der Veranstalter. Nicht anders kann es Musikern gehen, die auf Grund ihrer Haartracht mit einem Mal als ›unmöglich‹ gelten. Wer sich nicht unmöglich machen will, wird daher genau hinhorchen müssen, was zu sagen opportun ist und vor allem penibel alles vermeiden, was in der neuen Kultur als geächtet gilt. Um es mit einem
Wort zu sagen, man muss in der neuen Kultur des Wokeismus woke sein. Womit der Wokeismus im Furor seines Cancelns auch aufräumt, das ist die Bewegung der Aufklärung. Und so gelten neu nicht mehr Individuen, sondern kollektive Identitäten, nicht mehr Argumente, sondern Glaubensüberzeugungen. Damit aber unterminiert die neue Kultur ihre eigene Grundlage, weswegen man bereits heute, auf dem Höhepunkt seiner Wirkung, vom Ende des Wokeismus reden kann.
CoronaSoma - Leib in Zeiten der Pandemie:
Die Pandemie-Abwehrmaßnahmen haben auch Einfluss auf das Lebensgefühl von Menschen und dies in einem fundamentalen Sinn: Die Maßnahmen betreffen nicht nur unser Wohlbefinden und machen, dass wir uns unwohl, traurig oder beklemmt fühlen, sondern verändern unsere primäre Selbstwahrnehmung und das heißt, unsere Leibwahrnehmung. So nimmt der körperliche Abstand von anderen Menschen, die Verhüllung von Gesichtern und die Abnahme von realen Begegnungen und ihr Ersatz durch Online-Treffen uns die Gelegenheit, uns selbst leiblich zu spüren. Der Essay geht den leibbezogenen Auswirkungen der Pandemie-Abwehrmaßnahmen nach und fragt, ob wir am Beginn einer Neubewertung des Menschen stehen, der sich nicht mehr leiblich erleben und nur noch körperlich verstehen kann.
Mäusephilosophie:
Ob Wasserspitzmaus, Maulwurf oder Gartenschläfer – Lea Gredigs Zeichnungen geben spannende Einblicke in die bewegte Welt der kleinen Tiere. Vier Essays legen zudem dar, wie die Zeichnungen die Dialektik der Mäusephilosophie bei Aristoteles oder Albertus Magnus überwinden, wie sie durch vorurteilsloses Betrachten der lebendigen Tiere entstehen, warum sie nahe Verwandte des Comics sind und wie die Mausbewegungen zeichnerisch gestaltet werden. Ein Buch von grossem Reiz für alle an Zeichnungskunst, Philosophie und Zoologie Interessierten.
Coronaethik – Ein Fall von Global-Verantwortung?:
Die Corona-Pandemie, die seit dem Frühjahr 2020 fast die gesamte Welt bedroht, hat zu einer nie dagewesenen und weitgehend übereinstimmenden Abwehrstrategie geführt: Fast alle Staaten schränkten mit einem verordneten Lockdown das gesellschaftliche Leben in bisher nicht für möglich gehaltener Weise ein. Mit dieser Strategie sollte nicht nur die Ausbreitung des Virus eingeschränkt werden, sondern zugleich die Zahl der Erkrankungen so stark verringert werden, dass sowohl ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems als auch die Notwendigkeit einer Triage bei den Patienten, welche auf lebensrettende Beatmungsgeräte angewiesen wären, vermieden werden könnte. Bei so vielen ethisch gut begründeten Absichten geriet die Pandemie- Abwehrstrategie zu einem Lehrstück in Sachen praktizierter Verantwortung. Bei näherer Sicht auf die Corona-Krise stellen sich jedoch auch Fragen: Wie ist der Ausnahmenotstand, der das Leben vieler Menschen bestimmte, gerechtfertigt? Wie weit reichte die Verantwortung, auf welche sich die politischen Akteure beriefen und öffnete ihr Handeln nicht unerwartet eine Verantwortungslücke? Wie ist die gesellschaftliche Veränderung, die nicht durch die Pandemie, sondern durch die Pandemie-Abwehrstrategie ausgelöst wurde, zu beurteilen? Die Untersuchung will mit Blick auf »Corona« grundsätzlich das Handeln in einer Pandemie klären.